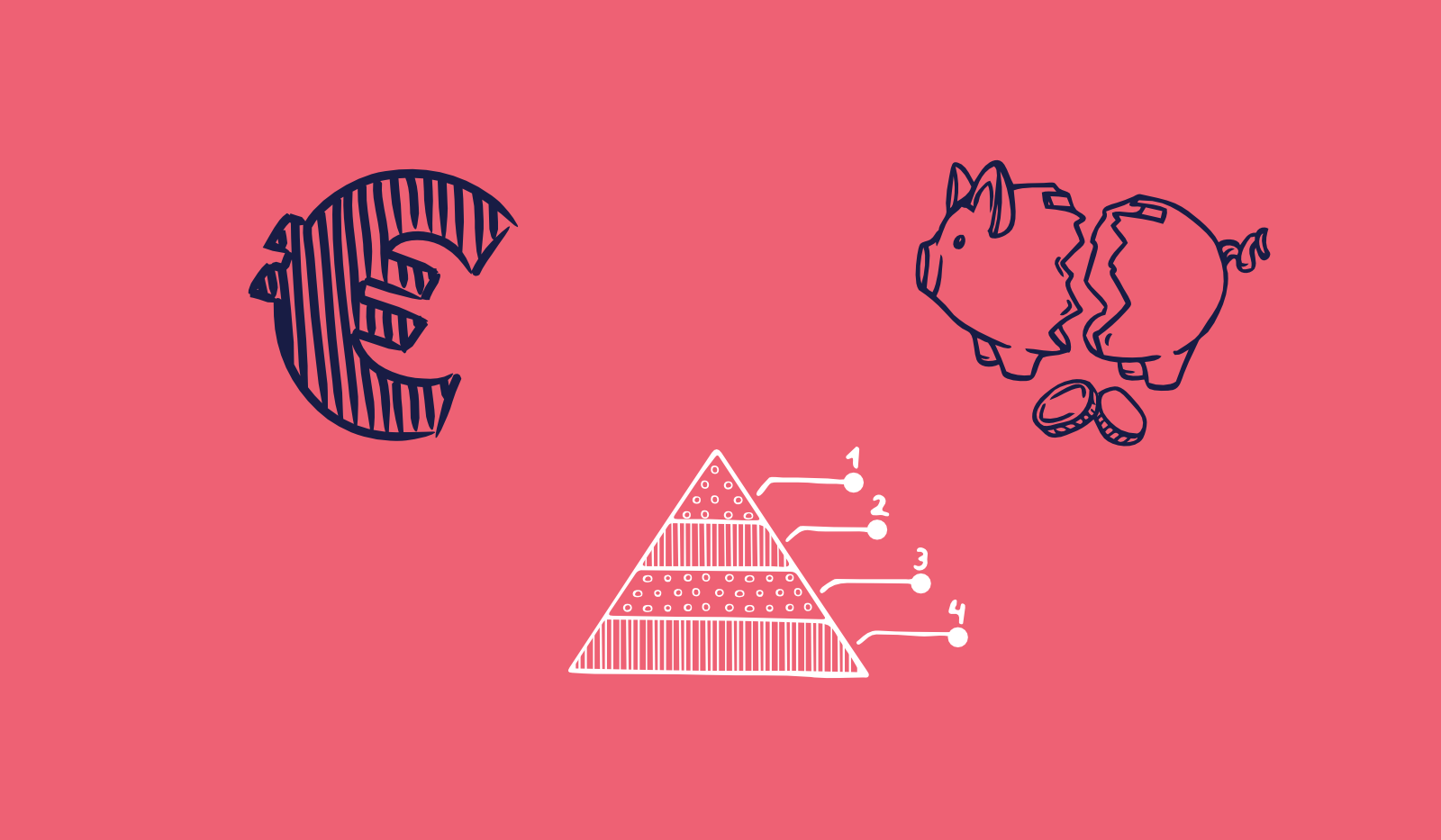Was ist der Fiskalmultiplikator, und warum ist er so kontrovers?
SEBASTIAN GECHERT
Teil 1: Grundlagen und Empirie
Welchen Einfluss haben Steueränderungen und Ausgabenentscheidungen des Staates auf das Wirtschaftswachstum? Diese Frage wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert; im Rahmen des post-COVID wirtschaftlichen Neustarts könnte sie bald erneut in den Vordergrund rücken. Zum einen, weil sie nur schwer zu beantworten ist. Zum anderen, weil die Antwort großen Einfluss auf wirtschaftspolitische Entscheidungen hat, die wiederum starke Verteilungswirkungen haben. Entsprechend prallen dabei oft auch gegensätzliche Interessen aufeinander.
Im Wesentlichen geht es dabei um eine einzige Kennzahl: Den Fiskalmultiplikator. Er beschreibt, wie viel zusätzliche Euro Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch einen zusätzlichen Euro Staatsausgaben (z.B. in Form öffentlicher Investitionen, Materialbeschaffung, öffentlicher Beschäftigung, Sozialausgaben) oder eine Steuersenkung (Verbrauchsteuern, Einkommensteuer, Unternehmenssteuern, Sozialversicherungs-Beiträge, etc.) entstehen (expansive Fiskalpolitik). Spiegelbildlich kann man den Multiplikatoreffekt auch für den Fall einer Senkung der Ausgaben oder eine Erhöhung der Steuern (kontraktive Fiskalpolitik) betrachten. Je nach der Art der Maßnahme und den Umständen, unter denen sie getätigt wird, dürfte sich der Multiplikatoreffekt unterscheiden.
Dabei gibt es ein paar bedeutende Schwellenwerte: ist der Multiplikatoreffekt größer 0, gibt es überhaupt erst einmal einen positiven BIP-Effekt. Bei negativen Werten würde das BIP schrumpfen, obwohl der Staat mehr Geld in die Hand nimmt oder Steuern senkt. Ist der Wert größer 1, dann heißt das, dass höhere öffentliche Ausgaben auch private Konsum- oder Investitionsausgaben im Inland nach sich ziehen und nicht etwa mit der größeren Staatsaktivität private Aktivität verdrängt wird (das sogenannte Crowding-Out). Zudem gilt ungefähr bei einem Wert größer 1, dass—obwohl der staatliche Impuls das Budgetdefizit erhöht—so viel zusätzliches BIP und so viel zusätzliche Staatseinnahmen entstehen, dass das Verhältnis aus Schuldenstand zu BIP letztendlich sinken kann.[1] Läge der Multiplikator noch deutlich höher (etwa bei 2,5), würden sich die Maßnahmen sogar komplett über höhere Steuern und geringere Subventionen und Sozialausgaben selbst finanzieren. Die Größe des Multiplikators beeinflusst also maßgeblich, ob Ziele wie BIP-Wachstum und proportionaler Schuldenabbau eher durch weniger oder durch mehr Staatsausgaben zu erreichen sind—gerade in den letzten Jahren (und vielleicht erneut in den kommenden) eine kontroverse Frage.
Empirische Schätzungen
Das zur Einordung. Aber wo liegen die Multiplikatorwerte nun tatsächlich? Lassen wir zunächst die Empirie sprechen:
Die empirische Literatur zum Multiplikatoreffekt ist seit 2007 stark gewachsen. Das lag vorrangig an zwei bedeutenden wirtschaftspolitischen Ereignissen: die weltweiten Konjunkturpakete zur Stützung der Wirtschaft im Rahmen der Finanzkrise und die anschließenden Austeritätsmaßnahmen, insbesondere im Euroraum ab 2010. Eine quantitative Literaturauswertung aus dem Jahr 2018 von 98 empirischen Studien, die über 1800 Multiplikatorschätzungen liefern (und an der der Autor dieses Textes selbst mitgewirkt hat), findet eine große Streuung der Multiplikatoren, stellt aber gleichzeitig einige zentrale Erkenntnisse heraus: Ausgabenseitige Maßnahmen haben im Schnitt einen Multiplikatoreffekt von etwa 0,8 nach 2 Jahren, der damit tendenziell höher liegt als bei einnahmenseitigen Maßnahmen (ca. 0,7). Deutlich höhere Effekte über eins findet man im Schnitt für öffentliche Investitionen und für ausgabenseitige Maßnahmen in Phasen eines Abschwungs. Die Multiplikatoren von einnahmeseitigen Maßnahmen hingegen werden von Auslastungsgrad und konjunktureller Lage tendenziell nur wenig beeinflusst. Einen Überblick bietet Abbildung 1.
Abbildung 1: Fiskalmultiplikatoren nach Art des Impulses und je nach konjunktureller Lage. Dicke Linien = Durchschnittswerte, gepunktete Linien = 95% Konfidenzintervall; eine flache Linie signalisiert Konjunkturunabhängigkeit, eine steile Linie zeigt konjunkturbedingte Unterschiede auf
Quelle: adaptiert aus Gechert und Rannenberg (2018)
Dass der Multiplikator auf der Ausgabenseite höher ist als auf der Einnahmeseite und dass Multiplikatoren im Abschwung größer sind, ist in der Literatur nicht unbestritten: Rameys Literaturüberblick (2019) kommt eher zu gegenteiligen Ergebnissen, ist aber auch selektiver bei der Auswahl der betrachteten Studien. Sie schlussfolgert, dass ausgabenseitige Multiplikatoren zwischen 0,6 und 1 liegen—auch in normalen Abschwüngen—, in tiefen Wirtschaftskrisen könnten sie gegebenenfalls größer ausfallen. Hingegen konstatiert sie für Steuersenkungen größere Effekte, mit Multiplikatoren von 2 bis 3, bezieht sich dabei aber nur auf Studien, die eine bestimmte Schätzmethode anwenden. Die Simulationsstudie von Caldara und Kamps (2017), die verschiedene Ansätze vergleicht, kommt hingegen zum selben Schluss wie die eingangs erwähnte Metastudie: Staatsausgaben haben tendenziell höhere Multiplikatoren als Steuersenkungen.
Wie kommen diese widersprüchlichen Aussagen und die große Bandbreite von Schätzergebnissen—gerade auf der Einnahmeseite—zustande? Dafür gibt es mehrere Gründe. Messunsicherheiten und Länderspezifika liegen auf der Hand. Obendrein gibt es vor allem keine perfekte Methode, um die gegenseitigen Einflüsse vom Staatsbudget zum Wirtschaftswachstum (Multiplikator) und vom Wirtschaftswachstum zum Staatsbudget (Budgetsensitivität) in den Daten einwandfrei zu trennen (das sogenannte Identifikations- oder Endogenitätsproblem). Daher müssen notwendigerweise Annahmen über diese Beziehung getroffen werden, die eben falsch und vor allem unterschiedlich sein können.
So finden Capek und Cuaresma (2019) in einer Simulationsstudie, dass die Ergebnisse von Multiplikatorschätzungen sehr stark von einigen eher unverdächtigen Annahmen abhängen. Diese Studie hat zwar ihre eigenen Probleme, weil sie selbst auf vergleichsweise kurzen und volatilen Datensätzen beruht, wodurch die Ergebnisse auf Annahmeänderungen stärker reagieren. Aber richtig ist, dass man seitens der Politik damit leben muss, dass die empirische Forschung keine gesicherten Erkenntnisse für einen konkreten Anwendungsfall liefern wird.
Am Ende bleibt zumindest ein Plausibilitätstest: Multiplikatoren über 2,5 sind wohl mit einiger Skepsis zu betrachten, denn dann wächst die Wirtschaft so stark, dass die damit einhergehenden Mehreinnahmen und Minderausgaben eine komplette Selbstfinanzierung des ursprünglichen Impulses bedeuten, was mit Blick auf die Vergangenheit eher unglaubwürdig erscheint. Auf der anderen Seite des Spektrums erscheinen negative Multiplikatoren, die bedeuten würden, dass höhere Staatsausgaben oder Steuersenkungen das BIP mindern, genauso unglaubwürdig. Es gibt wohl auch eher Belege dafür als dagegen, dass die empirischen Multiplikatoreffekte in Zeiten der wirtschaftlichen Unterauslastung—sprich in Konjunkturkrisen—größer und dauerhafter sind, als gemeinhin von den Entscheidungsträgern und einflussreichen Institutionen vor der Finanzkrise angenommen wurde. Die relevanten Modelle dieser Zeit unterstellten in der Regel einen Effekt von etwa 0,5—unabhängig vom Auslastungsgrad und der Art des Impulses.
Teil 2: Ideengeschichte und Makro-Theorie
Im Teil 1 haben wir uns vor allem die Empirie angeschaut. Welche theoretische Grundlage haben aber die Schätzwerte und wie hat sich die Theorie im Laufe der Zeit verändert?
Die Grundidee des Multiplikatorprinzips ist alt. Sie geht zurück auf das sogenannte Tableau Économique von Francois Quesnay aus dem Jahre 1758: Zusätzliche Ausgaben des Staates, die neue Jobs und höhere Einkommen entstehen lassen, bedeuten zusätzliche Einnahmen der Haushalte, die dadurch zu zusätzlichem Konsum angeregt werden (die Rolle von Unternehmen lassen wir zunächst außen vor). Daraus entstehen in der einfachen Theorie weitere Einnahme- und Ausgabekaskaden, die mit der Zeit versanden und am Ende k mal dem ursprünglichen Impuls entsprechen; k ist die Größe des Fiskalmultiplikators.
Richard Kahn und John Maynard Keynes verhalfen in den 1930er Jahren der Idee zu großer Popularität (und stellten damit auch den akademischen Hintergrund für Franklin D. Roosevelts New Deal). Noch heute nimmt beinahe jede Einführungsvorlesung zur Makroökonomie Bezug zum Keynesianischen Kreuz (Original von Paul Samuelson 1948) oder zum IS-LM Modell (von John Hicks 1937), in denen der Multiplikatoreffekt eine tragende Rolle spielt.
Entscheidend für die Größe des Multiplikatoreffekts in diesen einfachen statischen Modellen ist die sogenannte marginale Konsumneigung, also wie viel Cent von einem zusätzlichen Euro Einkommen ein Haushalt wieder ausgibt. Um diese Größe zu ermitteln, dienten in den anfänglichen empirischen Arbeiten einfache Schätzungen von Konsumquoten: Haushalte gaben im Durchschnitt 80% ihres verfügbaren Einkommens für den Konsum aus.
Daraus ergibt sich ein simples Rechenbeispiel: ist die marginale Ausgabenneigung im Durchschnitt gleich 0,8, würde ein zusätzlicher Euro Staatsausgaben einen Multiplikatoreffekt von k = 1+0,8+0,8²+0,8³+…=1/(1-0,8) = 5 ergeben. Jeder Euro zusätzliche Staatsausgaben würde also letztlich 5 Euro zusätzliches BIP erzeugen. Mit Steuersenkungen, die ja das verfügbare Einkommen erhöhen funktioniert das im Prinzip genauso, hier fehlt lediglich der direkte Erstrundeneffekt auf das BIP (die ‚1‘ im Zahlenbeispiel). Dadurch wäre der Effekt hier „nur“ k = 0,8+0,8²+0,8³+…=0,8/(1-0,8) = 4.
Was auf den ersten Blick bestechend logisch erscheint, wirft bei erneuter Betrachtung einige Fragen auf (nicht nur, weil die Werte im Vergleich zur Empirie so groß sind). Bleiben wir zunächst auf der Makroebene und ordnen die Einflusskanäle aufsteigend nach Kontroversität zwischen den verschiedenen Denkschulen:
- Es dürfte klar sein, dass in einer offenen Volkswirtschaft ein Teil der Konsumausgaben im Ausland landet, sprich für importierte Waren oder im Urlaub ausgegeben wird, und damit nicht das heimische BIP anregt. Je größer diese Importneigung, desto kleiner der Multiplikator.
- Außerdem greift der Fiskus das, was er mit der einen Hand ausgegeben hat, mit der anderen Hand teilweise wieder ab: mittels steigender Konsum- und Einkommensteuereinnahmen aber auch durch Minderausgaben für Sozialleistungen, wenn aufgrund des Impulses neue Jobs geschaffen wurden. Je größer der Staatsanteil am BIP, desto kleiner tendenziell der Multiplikator.
- Zudem ist es entscheidend, wie stark die betrachtete Wirtschaft ausgelastet ist: können die Unternehmen auf die zusätzliche Nachfrage überhaupt mit Mehrproduktion (und Neueinstellungen) reagieren, oder geht der Impuls nur in die Preise und erhöht damit die Realeinkommen gar nicht (Preis-Crowding-Out)? Je geringer die Kapazitätsauslastung, desto geringer das Preis-Crowding-Out und desto höher ist tendenziell der Multiplikator.
- Auch eine Zinsreaktion in Abhängigkeit der Auslastung ist zu erwarten: brummt die Wirtschaft, dürfte zusätzliche Staatsnachfrage tendenziell die Finanzierungszinsen steigen lassen und dadurch Konsum- und Investitionsnachfrage hemmen, auch weil die Geldpolitik dann vermutlich stärker bremst (oder weniger stark stützt). In einer Rezession dürfte die Zinsreaktion weniger ausgeprägt sein oder könnte sich sogar umkehren. Dazu später mehr.
Unterstellt man realistische Größenordnungen für diese Kanäle, dann würde man mit einem derart angepassten Modell für eine durchschnittliche Volkswirtschaft mit unterausgelasteten Kapazitäten einen Ausgabenmultiplikator für staatlichen Konsum von etwas kleiner als 1 erwarten, einen Steuermultiplikator der noch etwas darunterliegt und einen Multiplikator öffentlicher Investitionen der etwas darüber liegt, weil er die Kapazitäten erweitert, gegebenenfalls noch private Investitionen anregt und dadurch gleichzeitig das Preis-Crowding-Out mindert. Für eine große geschlossene Volkswirtschaft wie die USA werden diese Werte etwas höher ausfallen, für eine kleine offene Volkswirtschaft mit unabhängiger Geldpolitik niedriger. Diese Effekte passen im Prinzip ganz gut zu den empirischen Werten aus Teil 1.
Ende der Geschichte? Nein, denn die zugrundeliegenden Verhaltensannahmen auf der Mikroebene wurden von Beginn an immer wieder kritisiert und haben sich im Verlauf der Dogmengeschichte deutlich verändert, wie in Teil 3 beschrieben wird.
Teil 3: Von Makro zu Mikro: Annahmen über individuelles Verhalten und ihr Effekt auf den Multiplikator, sowie die Nullzinsgrenze
Im Teil 2 wurden vor allem gesamtwirtschaftliche Kanäle des Multiplikators beschrieben. Allerdings hängen auch diese makroökonomischen Wirkungen von den Verhaltensannahmen auf der Haushaltsebene ab.
Im einfachen keynesianischen Modell von Teil 2 bleibt zunächst unbeantwortet, innerhalb welchen Zeitraums die beschriebenen Ausgabenkaskaden stattfinden sollen, denn es vergleicht nur zeitlose Gleichgewichtszustände (ohne den Fiskalimpuls vs. mit dem Fiskalimpuls) und die Wirkungskette erscheint doch arg mechanistisch. Um aber wirtschaftspolitisch relevante Aussagen machen zu können, z.B. ob ein staatlicher Impuls rechtzeitig hilft, um einen Konjunkturabschwung abzufedern, ist die Frage nach dem wann sehr entscheidend. Mit dynamischen Modellversionen der keynesianisch-neoklassischen Synthese basierend auf ersten Zeitreihendaten in den 1960er Jahren wurde versucht, diese Frage zu beantworten. Diese Modelle ergaben, dass ein großer Teil der Effekte innerhalb der ersten 2 Jahre entstehen würde.
Mit der Frage nach der Dynamik ist auch die Frage nach den Erwartungen der privaten Akteure angesprochen. Wie reagieren Haushalte auf die höhere Staatsaktivität? Im simplen Modell folgen sie stoisch ihrem Konsummuster: Kommt zusätzliches Geld in die Kasse, fließt es mit festem Anteil innerhalb derselben Periode (Ein Tag? Eine Woche? Ein Quartal? Ein Jahr?) wieder heraus. Sie bilden adaptive (rückwärtsblickende) Erwartungen. Ist das realistisch? Verfechter rationaler (vorwärtsblickender) Erwartungen würden sagen: nein!
Ein Vordenker dieser Ideen zur Erwartungsbildung und prägende Kraft der monetaristischen Denkschule war Milton Friedman. Er stellte in den 1950er Jahren die permanente Einkommenshypothese auf, nach der Haushalte erwartete Einnahmen und Ausgaben über ihr gesamtes Leben hinweg angleichen würden. Sie würden bei ihren Konsumausgaben weniger auf ihr aktuelles Einkommen achten und wären stattdessen darauf bedacht, einen möglichst gleichmäßigen Konsum über ihr Leben zu verwirklichen.
Erwartete dauerhafte Einkommensänderungen wären dabei schon eingepreist und würden den Konsum gar nicht verändern. Unerwartete temporäre Einkommenserhöhung (z.B. in Form eines konjunkturstützenden Konsumschecks, wie im Rahmen der Finanz- und Coronakrisen in den USA praktiziert, oder etwa in Deutschland durch den einmaligen Kinderbonus im Jahr 2009) wäre ziemlich unbedeutend für das Lebenseinkommen und würde daher kurzfristig kaum die Ausgaben erhöhen. Die marginale Konsumneigung in der kurzen Frist wäre nahe null.
Lediglich unerwartete permanente Einkommenserhöhungen hätten einen starken Konsumeffekt, denn sie erhöhen sofort und substantiell das erwartete Lebenseinkommen und der Haushalt passt daran unmittelbar seinen Konsum 1:1 an.
Dass jedoch selbst permanente expansive Fiskalpolitik nicht notwendigerweise zu hohen Multiplikatoreffekten führt, wird bei den Monetaristen entweder durch eine bremsende Reaktion der Zentralbank verhindert oder weil es letztlich nur in Preissteigerungen ohne reale Wohlfahrtseffekte mündet. Im Gegensatz dazu könnten niedrigere Steuern auf Kapital und Arbeit längerfristig höhere Effekte mit sich bringen, weil sie Verzerrungen von Leistungsanreizen reduzieren würden und folglich Kapazitätsausweitungen mit sich bringen würden.
In den Keynesianischen Modellen, aber auch bei Friedman wurde der Multiplikatoreffekt primär über einen Konsumnachfragekanal beschrieben. Mit rationalen Erwartungen der in den 1970er Jahren aufkommenden Neuklassischen Theorie verläuft die Wirkung jedoch ganz anders: Haushalte optimieren demnach über ihren gesamten Lebenslauf zwischen Konsum und Freizeit (Lebenszeit minus Arbeitszeit). Gibt der Staat nun mehr Geld aus, erhöht das die aktuelle Arbeits- und Kapitalnachfrage (bei zunächst fest gegebenem Angebot). Löhne und Zinsen steigen. Das regt die Haushalte an, heute mehr zu arbeiten und zu sparen (und weniger zu faulenzen und zu konsumieren). Die Konsumeinschränkung ergibt sich in diesen Modellen auch daraus, dass der Staat mit seiner Mehrnachfrage auf dem Gütermarkt private Konsumnachfrage verdrängt. De facto sinkt also in der kurzen Frist der Konsum sogar, aber es wird mehr gearbeitet und investiert und dadurch entsteht ein größeres BIP. Langfristig dreht sich der Effekt spiegelbildlich ins Gegenteil, es wird mehr konsumiert aber weniger gearbeitet. Da die Haushalte in solchen Modellen einen sehr langen Planungszeitraum haben, bekommt der intertemporale Zinskanal ein enormes Gewicht. Der Multiplikatoreffekt wird in der Neuklassik zu einem angebotsseitigen Effekt, der in der einfachsten Variante kurzfristig positiv, mittel- bis langfristig negativ und damit in Summe gleich null ist.[2] Für Steuersenkungen bei den verzerrenden Steuern gilt wiederum in diesen Modellen, dass sie Arbeits- und Sparanreize erhöhen und folglich kurz- und langfristig positive Effekte bringen, sofern sie in der Zukunft nicht durch andere verzerrende Steuern wieder ausgeglichen werden.
Geht man—wie im Neukeynesianischen Paradigma der 1990er Jahre zunächst üblich—von diesen neuklassischen Verhaltensannahmen aus und kombiniert sie mit einigen Friktionen, die die Anpassungen von Sparen, Arbeiten, Konsumieren und Investieren an die fiskalpolitische Maßnahme etwas behäbiger machen (z.B. verzögerte Preis- und Lohnanpassungen, Rüstkosten für Investitionen, Konsumgewohnheiten), erhält man letztlich ein Gemisch der nachfrage- und angebotsseitigen Effekte. Es ergibt sich dann ein Multiplikatoreffekt von etwa 0,5 für Einnahme- und Ausgabeseite (wiederum ist der Effekt etwas größer bei öffentlichen Investitionen, die die Kapazitäten erweitern). Dies war der Wert, von dem die meisten Institutionen vor der Finanzkrise ausgegangen sind.
Die Nullzinsgrenze
Seit der Finanzkrise wird im Rahmen Neukeynesianischer Modelle verstärkt über den Fall der Nullzinsgrenze (Zero-Lower-Bound, ZLB) diskutiert, unter die die Geldpolitik den Leitzins nur schwer bis gar nicht drücken kann. Läge der von diesen Modellen berechnete optimale Leitzins aufgrund einer starken Rezession im negativen Bereich, könnte die Geldpolitik nicht auf die Fiskalpolitik reagieren, da der Leitzins so oder so bei 0% verbleibt. Dadurch fällt die bremsende Wirkung des Zinskanals aus und der Multiplikator ist größer. Er wird sogar noch größer, weil die Inflation höher ausfällt und somit bei konstantem Nominalzins der eigentlich entscheidende Realzins sinkt.[3] Die Effekte der ZLB sind weitestgehend spiegelbildlich für expansive und kontraktive Fiskalpolitik denkbar.
Im Rahmen der Krise im Euroraum ab 2010 spielte der Fall staatlicher Sparpolitik eine große Rolle: obwohl die EZB schon nahe der Nullzinsgrenze war und nicht weiter stützend reagierte, schwenkten die Länder auf eine konzertierte Austeritätspolitik ein. Da die Geldpolitik den Leitzins nicht abfedernd weiter absenken konnte, wird hier von größeren schädlichen Effekten der Sparmaßnahmen ausgegangen.
Die Wirkungen der Nullzinsgrenze sind allerdings nicht unumstritten. Zum einen ergeben sich unglaubwürdig große Unterschiede, je nachdem, ob der Fiskalimpuls auf die Nullzinsphase beschränkt bleibt (großer Multiplikator), oder darüber hinausgeht (eventuell sogar negativer Multiplikator). Zum anderen hat die Geldpolitik auch unkonventionelle Maßnahmen wie Quantitative Easing und Forward Guidance entwickelt, die die Nullzinsgrenze unwirksam oder zumindest schwächer machen könnten.
Ist der Zinskanal also doch wirkmächtig und die Multiplikatoren klein? Dagegen spricht einerseits die in Teil 1 zitierte makroökonomische Empirie und andererseits viele Untersuchungen auf Haushaltsebene, die eine starke Konsumreaktion selbst bei erwarteten und vorübergehenden Einkommensänderungen finden. Diese Erkenntnisse finden in den neueren Modellen Berücksichtigung, wie der letzte Teil zeigt.
Teil 4: Multiplikatortheorie heute
In Teil 3 wurden die theoretischen Diskussionen bis zur Finanzkrise und der Fall der Nullzinsgrenze diskutiert. Dabei blieben aber einige Fragen offen: insbesondere lieferten die Vorkrisenmodelle Multiplikatorschätzungen von 0,5; die empirische Forschung, präsentiert in Teil 1, zeigt jedoch, dass gerade in Krisen Werte über 1 realistischer sind.
Viele aktuelle Modelle versuchen daher realistischere Alternativen zur Vorkrisen-Modelllandschaft zu entwickeln, in denen dem Zinskanal und dem erwarteten zukünftigen Einkommen weniger Bedeutung zukommt. Aktuelle Einkommen und Vermögen der Haushalte werden dadurch wichtiger für deren Konsumentscheidungen. So wird in neuen Modellen inzwischen die Unsicherheit des zukünftigen Einkommens stärker betont, was dazu führt, dass Haushalte Vorsichtssparen betreiben und die Zukunft deutlich stärker diskontieren. Der zu erwartende Multiplikator ist dadurch höher.
Alternativ oder ergänzend könnten einige Haushalte liquiditätsbeschränkt sein (z.B. ärmere Haushalte, die es sich nicht leisten können zu sparen oder keinen Kredit bekommen oder reichere Haushalte, deren Vermögen allerdings in Immobilien steckt und illiquide ist). Sie müssen deshalb ihre Konsumentscheidungen stärker an ihren aktuell verfügbaren Ressourcen ausrichten, wodurch diese eine höhere marginale Konsumneigung aufweisen als unbeschränkte Haushalte.
Da diese Eigenschaften in der Bevölkerung je nach Erwerbsstatus und Einkommenshöhe nicht gleich verteilt sind, kann auch Umverteilung von reich zu arm einen positiven Nettoeffekt aufweisen. Zudem könnte es sein, dass eine Nachfragestabilisierung in einer Krise durch die Fiskalpolitik den Akteuren eher Zuversicht vermittelt und die Zinsen sogar senkt, statt sie zu erhöhen.
Das würde dafür sprechen, dass Multiplikatoren durch den Zinskanal weniger eingeschränkt werden und der angebotsseitige Kanal an Bedeutung verliert. Das führt auch dazu, dass die ausgabenseitigen Maßnahmen in solchen Modellen tendenziell wieder höhere Multiplikatoren aufweisen als einnahmeseitige. Alles in allem nähern sich diese Modelle wieder stärker den ursprünglichen Keynesianischen Multiplikatoreffekten an, warten dabei aber mit realistischeren Verhaltensannahmen und einer Fülle von Einflussfaktoren auf.
Derartige Modelle zu größerer Anwendungsreife zu bringen, sie weiter empirisch zu unterfüttern und sie aus pluraler Perspektive mit weiteren relevanten Wirkungskanälen auszustatten dürfte ein großes und spannendes gemeinsames Forschungsprojekt der kommenden Jahre sein. Als Fazit lässt sich festhalten, dass eine aktive Fiskalpolitik gerade in Krisenzeiten wirksam zu sein scheint. Auch wenn in der aktuellen Corona-Krise angebotsseitige Faktoren (internationale Lieferketten, Produktionsstopps) eine große Rolle spielen, so dürfte ein substantieller staatlicher Nachfragestimulus unverzichtbar sein, um die Wirtschaft nach den Angebotsbeschränkungen wieder anzukurbeln. Denkt man noch einen Schritt weiter, so dürften höhere öffentliche Investitionen, die auch in wirtschaftlich normalen Zeiten einen hohen Multiplikatoreffekt haben, ein wesentliches Element einer nachhaltigen Wachstumsstrategie sein.
Fußnoten
[1] Das hängt allerdings von weiteren Faktoren ab und der kritische Wert kann auch schon bei 0,6 liegen, wie hier beschrieben wird. Im Umkehrschluss bedeuten Werte von größer 1, bzw. größer 0,6, dass Austeritätspolitik die Schuldenquote steigern kann, da BIP und Steuereinnahmen in solchem Maße wegbrechen, dass trotz Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen die Schuldenquote steigt.
[2] Unterstellt man zusätzlich, dass die Haushalte bei höherem Staatsdefizit heute höhere Steuern morgen erwarten (sog. Ricardianische Äquivalenz) dann gehen diese Haushalte von einem geringeren Nettolebenseinkommen aus. Dieser negative Vermögenseffekt sorgt permanent für höheren Arbeits- und Spareifer und der Multiplikator kann auch in Summe über die Zeit leicht positiv sein, er ist aber bereits kurzfristig klein.
[3] Ein ähnlicher Effekt entsteht unabhängig von der Nullzinsgrenze auch, wenn die Geldpolitik nicht für die Konjunktursteuerung eines einzelnen Landes, sondern für einen ganzen Währungsraum zuständig ist und entsprechend weniger stark auf fiskalpolitische Maßnahmen in einzelnen Ländern reagiert; oder wenn sie statt der Konjunktursteuerung den Wechselkurs der Währung bei hoher internationaler Kapitalmobilität zu steuern versucht (vergleiche das traditionelle Mundell-Flemming-Modell).
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte