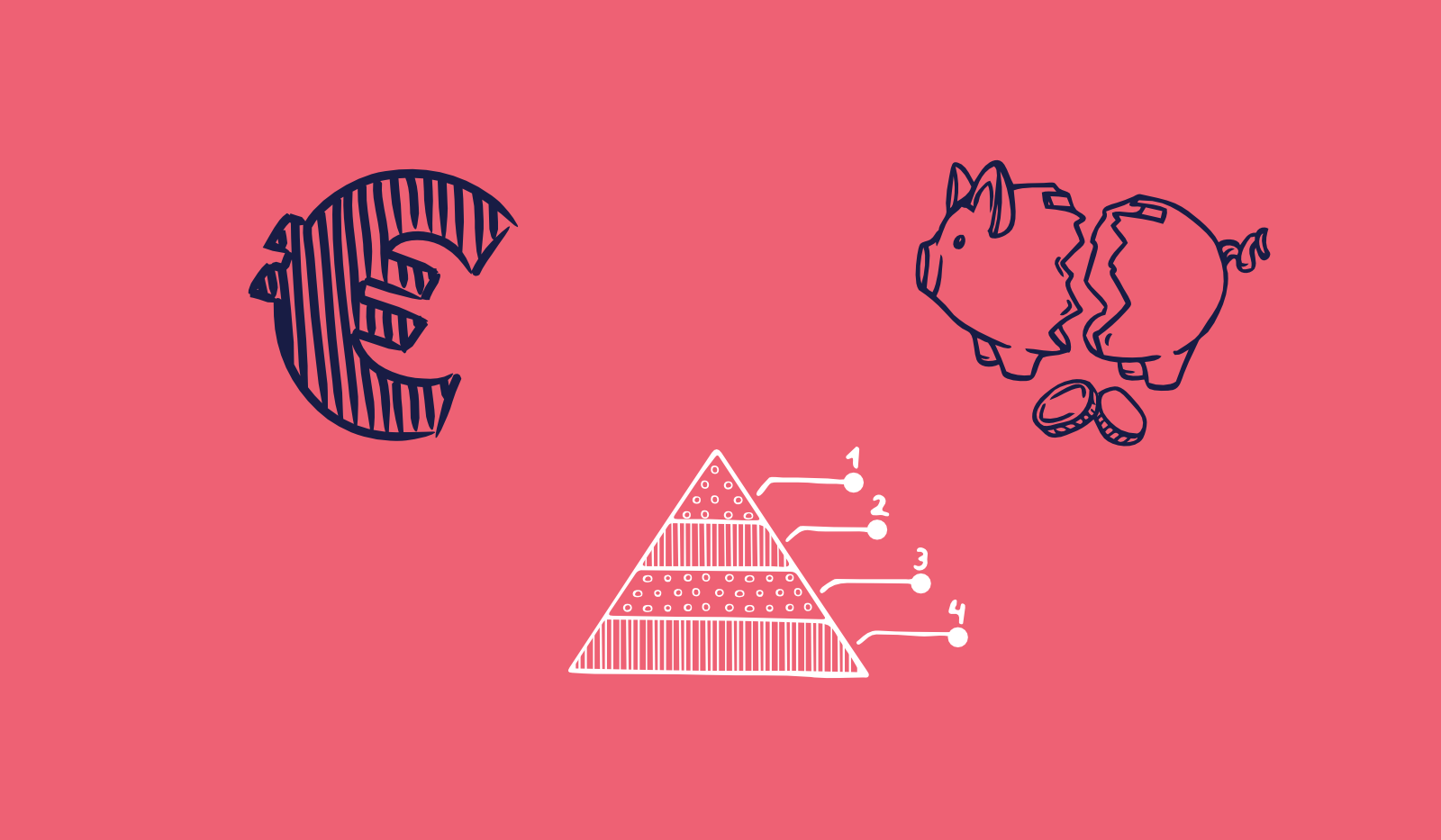Dialog mit Xavier Jaravel – Für eine systemische Sicht auf Innovation
« Man sollte Innovation nicht als Trickle-Down, sondern als Rhizom begreifen.»
Xavier Jaravel veröffentlichte im November 2023 sein Buch „Marie Curie wohnt im Morbihan“ (im französischen Original „Marie Curie habite dans le Morbihan“). In diesem Essay stellt er Innovation in einem neuen Licht dar. Er verteidigt eine wesentliche Abkehr vom klassischen Innovationsmodell, nach welchem sich die Vorteile einer zentralen Innovation auf die gesamte Wirtschaft ausbreiten würden. Als Gegenmodell entwickelt er das Konzept des „Rhizoms“, ein Netzwerk ohne oben, unten oder Zentrum: Innovationen entwickeln sich unter dem gegenseitigen Einfluss vieler Akteure, die gleichzeitig arbeiten. Die Arten der Erfindungen hängen von den soziodemografischen Merkmalen der Innovator:innen ab und kommen hauptsächlich jenen Bevölkerungsgruppen zugute, die ihnen gesellschaftlich nahestehen. Seine Perspektive hat überraschend weitreichende Implikationen für die Bildungs- Handels- Regional- und Klimapolitik sowie für die europäische Integration.
Das Interview führte unsere Partnerorganisation Institut Avant-garde auf Französisch, die Übersetzung stammt von Jonas Kaiser. Es gliedert sich in vier Teile: Zunächst geht es um die Hauptthesen des Buches. Anschließend konzentriert sich die Diskussion auf die Verbindung zwischen Innovationen und ihren Innovator:innen, gefolgt von einer Betrachtung der gerechten Transformation. Zum Abschluss stehen Empfehlungen für die Politik im Mittelpunkt des Dialogs.
Institut Avant-garde: Die Frage nach der Beziehung von Innovation, Marktgröße und Ungleichheiten steht im Mittelpunkt Ihres Essays. Könnten Sie uns diesen Zusammenhang näher beschreiben?
In diesem Punkt, wie auch in anderen Punkten des Buches, stütze ich mich auf aktuelle Forschungsarbeiten und fasse deren Hauptergebnisse zusammen. Es geht darum zu verstehen, was Innovation bestimmt. Hierzu gibt es zwei große Ideen. Eine mögliche Sichtweise ist, dass Innovation aus Erkenntnissen hervorgeht, die aus der Grundlagenforschung stammen, und wirtschaftliche Anreize daher zweitrangig sind. Die andere Sichtweise ist, dass wirtschaftliche Anreize an erster Stelle stehen und dass Innovationen je nach Anreizen unterschiedlich ausfallen.
Tatsächlich sieht man in den Daten, dass diese zweite Sichtweise viele der Unterschiede in der Innovation zwischen verschiedenen Sektoren erklärt, und Marktgröße spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Die Idee ist einfach: Wenn Sie einen ausreichend großen Markt haben, können Sie die notwendigen Investitionen tätigen, um in diesem Markt zu innovieren. Mehr als die Marktgröße selbst ist es empirisch gesehen vor allem das Wachstum der Marktgröße, das zählt. Es wird interessant zu investieren und mehr zu innovieren, um sich seinen Anteil an einem wachsenden Markt zu sichern.
Um ein paar Zahlen zu nennen: Die Vergrößerung eines Marktes um 10% führt im Durchschnitt zu einem Rückgang der qualitätsbereinigten Preise (das heißt unter Berücksichtigung neuer Produkte und Produkteigenschaften) von etwa 3%.
Das Beispiel der USA zeigt, wie diese Innovationsdynamiken, die durch die Marktgröße angetrieben werden, Ungleichheiten verstärken können. In den USA nimmt die Einkommensungleichheit zu, im Gegensatz zu Frankreich. Und somit werden die Reichen schneller reicher als alle Anderen. Die Märkte für Güter, die vorwiegend von Reichen gekauft werden, wachsen schneller als andere Märkte, und so gibt es mehr Innovationen in diesen Segmenten. Nehmen wir nur ein Beispiel: Bioprodukte. Es gibt eine große Nachfrage danach, insbesondere durch junge Menschen mit hohem Einkommen, und folglich viele Innovationen in diesem Bereich. Und dadurch einen Preisrückgang.
Die Feststellung dieser Wechselwirkung schafft neue Beschränkungen. Was können wir tun, um diesen Beschränkungen zu begegnen?
In der Tat ist das eine Beschränkung, wenn ein großer Teil der Innovation von der Marktgröße abhängt. Das sollte man immer im Kopf behalten, insbesondere in Bezug auf Handelspolitik. Protektionismus schafft erhebliche Risiken für die Innovationsfähigkeit, wenn die Marktgröße zu stark reduziert wird. Das ist ein erster Punkt.
Der zweite Punkt ist, dass sich in einem Land wie den Vereinigten Staaten, wo die Ungleichheit zunimmt, Innovationen zunehmend auf Luxusmärkte konzentrieren. Und das ist eher eine schlechte Allokation von Innovation. Das zeigt also, dass die Besteuerung von Einkommen auch dazu dient, die Innovation umzulenken.
Schließlich gibt es einige Märkte, von denen man gesellschaftlich denkt, dass sie zu Innovationen führen sollten. Das passiert aber nicht, weil sie zu klein sind. Das kann zum Beispiel bei seltenen Krankheiten der Fall sein, auch in wohlhabenden Ländern. Ein typisches Beispiel sind Gesundheitsprobleme in Entwicklungsländern, etwa Impfstoffe gegen Malaria. Um dieser Herausforderung zu begegnen, können Instrumente entwickelt werden, bei denen der Staat die fehlende Nachfrage auf dem Markt ersetzt, um Innovationen in bestimmten Bereichen zu finanzieren. Das nennt man Advance Market Commitments, diese wurden zum Beispiel für Impfstoffe gegen Covid-19 verwendet.
Ihr Essay stellt eine klassische Erklärung für den Mangel an Innovation in Europa in Frage: Nämlich, dass dieser auf eine zu vorsichtige Haltung, auf kulturelle Fragen zurückzuführen sei. Sie bringen mit der zentralen Rolle potenzieller Marktgröße eine viel prosaischere Erklärung vor. Die amerikanischen und chinesischen Märkte sind viel größer. Welche Implikationen hat das für die Innovationspolitik in Frankreich und Europa?
Tatsächlich ist der europäische Markt noch zu segmentiert. Wir haben nationale Märkte, die relativ klein sind und sich nicht mit den USA oder China vergleichen lassen. Es gibt französische Start-ups, die hier in Frankreich beginnen und dann zum Wachsen in die USA gehen, weil sie direkten Zugang zu einem Markt von 300 Millionen Verbraucher:innen haben.
Was wir in Europa tun können, ist genau diese Barrieren im gesamteuropäischen Markt zu verringern. Das kann auf verschiedene Weisen geschehen. Zunächst mit sektoralen Regulierungen zu Themen wie KI und Blockchain oder allgemeineren, zum Beispiel vereinfachte Regeln für junge Unternehmen, damit diese problemlos in mehreren Ländern gleichzeitig operieren können. Das ist ein wichtiger Aspekt.
Der zweite ist die Debatte über die Globalisierung. Die Sichtweise, die ich vertrete, ist, dass man protektionistisch sein darf, aber auf eine gezielte Weise. Das ermöglicht es, sich nicht vom globalen Markt abzukoppeln, der für Länder wie Frankreich und auch für Europa insgesamt wesentlich ist. Ein Beispiel: Die Luft- und Raumfahrt, eine der Innovationskräfte in Frankreich, erzielt 95% ihrer Umsätze im Ausland – und den Großteil nicht in Europa, sondern weltweit. Das ist eine Tatsache, mit der man klug umgehen muss. Ein gezielter Protektionismus ermöglicht es, die Abhängigkeiten im Zusammenhang mit der Einfuhr kritischer Komponenten oder Rohstoffe aus dem Ausland zu verringern. Einen allumfassenden Protektionismus sollten wir hingegen vermeiden, um unsere Innovationsfähigkeit zu bewahren.
Sie haben die Beziehung zwischen nationaler und europäischer Ebene betont. Eine andere Analyseebene in Ihrem Buch ist die regionale. Können Sie uns in diesem Zusammenhang den Titel Ihres Buches erklären?
Der Titel fasst eine der Hauptideen des Buches zusammen. Nämlich, dass es einen ungenutzten Talentpool für Innovation gibt, verlorene Marie Curies, die sich weit verstreut in ganz Frankreich befinden. Das Buch zeigt, dass dies auf sämtliche Bevölkerungsgruppen zutrifft: für Frauen, aber ebenso für Menschen aus einkommensschwächeren Verhältnissen und insbesondere für bestimmte geografische Gebiete. Es gibt Menschen, die das Talent haben, Karriere in Innovation, Wissenschaft oder Unternehmertum zu machen. Warum Morbihan? Es ist das französische Département mit der niedrigsten Rate an Kindern, die Ingenieur:innen oder Forscher:innen werden, obwohl es gleichzeitig eines mit den besten Schulabschlussnoten ist. Das illustriert die Idee sehr gut.
Im Buch untersuche ich die Gründe, warum sich diese Menschen nicht für solche Karrierewege entscheiden. Das hat viel mit der eigenen Sozialisation, der Nachahmung von Zielen, die man sich setzt, und der Karrierewege, in die man sich projiziert, zu tun. Im Fall von Morbihan handelt es sich um ein Gebiet mit viel Tourismus und landwirtschaftlicher Aktivität, aber nicht um ein Innovationszentrum. Es gibt kein Innovationsökosystem wie an anderen Orten wie Grenoble, oder die Technologieparks von Sophia Antipolis in den Alpes-Maritimes. Diese Orte haben bereits ein Ökosystem, und das inspiriert zukünftige Generationen.
Eine der Hauptbotschaften des Buches ist, dass schulische und berufliche Orientierung, das Kennenlernen wissenschaftlicher und innovativer Berufe ein Hauptanliegen unserer Innovationspolitik sein sollte. Es gibt viele Verbände, die in diesem Bereich arbeiten. Aber es wird nicht als Priorität betrachtet und die finanziellen Mittel sind viel zu gering. Das Argument des Buches ist, dass das Wecken einer Berufung genauso wichtig ist wie die klassischen Instrumente der Innovationspolitik, wie die Forschungszulage oder die Finanzierung des Centre national de la recherche scientifique (Anm.: dt. „Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung“), weil es wirklich ein enormes unausgeschöpftes Talentpotenzial gibt.
Innovationen und Innovator:innen
Wir kommen später noch einmal im Detail auf die Frage der Bildungspolitik zurück. Sie sprechen von einer selektiven Soziodemografie der Innovator:innen, die heute noch zu eng gefasst ist. Das hängt genau mit dieser geografischen Frage zusammen. Welche wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen könnte eine Änderung dieser soziodemografischen Merkmale haben? Haben Sie Beispiele?
Was ich bereits angesprochen habe, ist die Unterrepräsentation von Frauen und Menschen aus einkommensschwächeren Verhältnissen in der Innovation. Diese Tendenz ist in Frankreich, aber auch in den USA, England, Schweden und anderen Ländern zu beobachten. Frankreich ist also in dieser Hinsicht nicht auffällig, die Diagnose fällt überall ähnlich aus.
Die Konsequenz ist, dass Innovation hauptsächlich denjenigen zugutekommt, deren Eltern bereits in der Welt der Innovation etabliert sind. Dies schafft bedeutende intergenerationelle Ungleichheiten, da Innovationen die höchsten Einkommen und die Vermögensbildung beeinflussen. Diejenigen, die Zugang zu diesen Karrierewegen haben, profitieren zuerst davon.
Eine weitere Konsequenz betrifft die Art der Erfindungen. Man sieht, dass die Identität des Innovators oder der Innovatorin die resultierende Innovation beeinflusst. Es geht nicht nur um Marktgröße, die soziodemografischen Merkmale der Innovator:innen spielen eine sehr wichtige Rolle. Ein markantes Beispiel ist Louis Braille, der im Alter von 5 Jahren erblindete und später das Blindenschriftsystem erfand.
Was können wir also tun? Man könnte denken, dass sich das nicht ändern lässt – dass Menschen unverrückbare Meinungen darüber haben, was sie tun wollen, aber das ist überhaupt nicht der Fall.
Ein sehr gutes Mikrobeispiel kommt aus Frankreich, von einer Studie der Paris School of Economics, die ein Programm der L’Oréal-Stiftung untersucht hat. Es handelte sich um eine kurze Intervention in Gymnasien, um wissenschaftliche Karrieren, die Arbeit in einem Forschungslabor etwa, oder Einstiegskurse für Ingenieure vorzustellen. Die Interventionen dauerten nur etwa zweieinhalb Stunden, aber die Initiative hatte einen signifikanten Einfluss auf den Wunsch, eine Karriere in diesen Bereichen zu beginnen – insbesondere bei mathematisch begabten Mädchen.
Ursprünglich entschieden sich unter den besten Mathematikerinnen 24% für eine wissenschaftliche Vorbereitungsklasse (Anm.: eine Vorbereitungsklasse, frz. classe préparatoire ist ein verbreiteter zwei- bis dreijähriger Abschnitt der höheren französischen Bildungslaufbahn nach dem Gymnasialabschluss). Nach der Intervention waren es 37% in den besuchten Klassen, während die Basisrate bei Jungen bei etwa 45% lag. Also, wenn das Ziel ist, Parität in wissenschaftlichen Vorbereitungsklassen zu erreichen, erreicht man dieses Ziel fast schon mit einer sehr kostengünstigen Maßnahme. Das zeigt die Macht schulischer Laufbahnberatung.
Darüber hinaus wird dieser Effekt nur beobachtet, wenn eine Frau den Karriereweg vorstellt. Dass es einen Unterschied gibt, ist nicht so überraschend, aber das Ausmaß ist bemerkenswert und zeigt die Bedeutung von Vorbildern, mit denen man sich identifizieren kann. Das verdeutlicht, dass es nicht nur ein Informationsproblem über Karrieren gibt, sondern auch ein Vorbildproblem.
Das wirft viele politische Fragen auf. Heute gibt es viel mehr Männer in diesen Berufen. Wenn Sie beispielsweise einen Tag zur Berufsorientierung veranstalten möchten, wird die natürliche Tendenz sein, das lokale Ökosystem einzuladen. Wenn es dabei um wissenschaftliche Berufe geht, werden die Eingeladenen hauptsächlich Männer sein. Daher muss das Programm auf nationaler Ebene so gestaltet werden, dass nicht nur Menschen aus der Region involviert sind, um die Effekte von Vorbildfunktionen optimal zu nutzen und alle Zielgruppen, insbesondere Frauen und Minderheiten, zu erreichen.
Ein weiteres Beispiel: In Großbritannien wurde Anfang der 2000er Jahre unter Tony Blair ein Schul- und Universitätsorientierungsprogramm namens „Aimhigher“ umgesetzt. Es wurde nicht kausal, sondern deskriptiv bewertet, aber man konnte sehr gute Ergebnisse beobachten.
Die Botschaft hier ist, dass es eine Priorität der Politik sein muss, all dies in großem Maßstab zu ermöglichen, indem viele Akteure, die bereits vor Ort aktiv sind, sowie viele Verbände, die heute wenig Finanzierung und Sichtbarkeit haben, mobilisiert werden. Das sind Dinge, die kurzfristig umgesetzt werden können, insbesondere im Rahmen der in Frankreich derzeit angekündigten Reformen zum Tag der Berufsorientierung.
Interessant ist auch der wissenschaftliche Ursprung dieser differenzierten Soziodemografie der Innovator:innen. Wie ist es dazu gekommen?
Was ich in meiner Forschung gemacht habe ist, dass ich neue Datenbanken erstellt habe, um die Identität und die soziale Herkunft der Innovator:innen zu identifizieren. Wir haben dies für die Moderne in den USA, Frankreich und anderen Ländern gemacht. Ein anderes Team hat sich die USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts angeschaut und kommt zum gleichen Ergebnis: Die Beziehung zwischen dem Einkommen der Eltern und der Wahrscheinlichkeit Innovator:in zu werden, ist über ein Jahrhundert hinweg ziemlich stabil.
So beobachtet man eine sehr starke Beziehung zwischen dem Einkommen der Eltern, dem Aufwachsen in einem privilegierten Umfeld und Innovation. Eine der intuitiven Erklärungen ist, dass Innovation eine gute Ausbildung erfordert, die historisch mit Einkommen verbunden war. Manchmal ist auch ein Startkapital erforderlich. Hat man erst einmal ein solches System, neigt es dazu, sich fortzusetzen, denn um auf diesen Karrierewegen Fuß zu fassen, ist es oft notwendig, von seinem Umfeld inspiriert zu werden. Insgesamt war das System schon immer extrem eingeschränkt und elitär bezüglich sozialer Herkunft der Unternehmer:innen und Innovator:innen.
Sie erwähnen die „Rhizom-Innovation“. Dieses Konzept hat unsere Aufmerksamkeit erregt, sodass wir gerne ausführlicher darüber diskutieren möchten. Was ist die Rhizom-Innovation und welche Rolle spielt das geistige Eigentum bei der Entwicklung dieser Innovationen?
Rhizom-Innovation ist eine Metapher, die ich vorgeschlagen habe, um eine gerechtere Alternative zur Idee des „Trickle-Down“ oder „Durchsickerns“ zu bieten, die oft verwendet wird. In der Botanik bezieht sich Rhizom auf unterirdische Sprossen, die bei einigen Pflanzen wie Kartoffeln, Reis, Bambus usw. vorkommen. Diese Sprossen ermöglichen es der Pflanze, sich fortzupflanzen. Das faszinierende am Rhizom ist die Abwesenheit von Hierarchie; es gibt weder oben, unten noch ein Zentrum. Das Netzwerk entwickelt sich unterirdisch und horizontal in alle Richtungen.
Diese Idee inspirierte einige Erkenntnistheoretiker wie Guattari und Deleuze, die im Rhizom eine Darstellung zentrumsloser Netzwerke sehen. Wenn man Innovation analysiert, kommt man zu ähnlichen Ideen: Viele Technologien entwickeln sich unter dem gegenseitigen Einfluss zahlreicher Akteure. Erfinder schaffen, aber es sind auch die Verbraucher, die sich anpassen und neue Verwendungen erfinden. Deshalb dauert es immer Jahrzehnte, bis sich Technologien verbreiten. Zum Beispiel hat sich die Elektrizität langsam ausgebreitet, genauso wie es bei Innovationen wie ChatGPT der Fall sein wird. Die Gesellschaft als Ganzes muss die Verbreitung von Innovationen akzeptieren, sei es bei Windrädern oder anderen Lösungen für den ökologischen Wandel. In diesem Rahmen muss man die Perspektive ändern, Innovation ist kein von oben kommendes Trickle-Down.
Bezüglich der Rolle des geistigen Eigentums und der rhizomartigen Aktivität: Ich glaube, das ist kompatibel. Das geistige Eigentum, insbesondere durch Patente, spielt in Wirklichkeit zwei verschiedene Rollen. Erstens verleiht es ein zeitlich begrenztes Recht auf eine Idee oder Technologie, was mit der Vorstellung von Marktgröße und finanziellem Anreiz verbunden ist. Zweitens erleichtert es die Verbreitung von Innovationen. Im Gegenzug für das Monopol, das Sie erhalten, stellen Sie Ihre Innovation der Öffentlichkeit zur Verfügung. Technologisch bedeutet das, dass andere auf dieser Innovation aufbauen können.
Die erste Funktion, die des finanziellen Anreizes, mag philosophisch im Widerspruch zur Idee des Rhizoms stehen. Sie etabliert eine Form des Eigentums, anders als bei Open-Source-Modellen, wo es kein Eigentumsrecht an einer Innovation gibt. Die zweite Funktion, die Verbreitung der Technologie, ist vollkommen kompatibel mit der Idee des Rhizoms.
Soziale Gerechtigkeit in der ökologischen Transformation
Sie sagen, dass sich Innovationen in kurzer Zeit verbreiten, aber die Dringlichkeit der ökologischen Transformation erfordert eine noch kürzere Zeit. Können wir uns allein auf Innovation verlassen, um den Übergang erfolgreich zu gestalten? Wie können wir ihn beschleunigen, wenn letztendlich Innovation und Bildung der Schlüssel sind?
Meine Interpretation der Literatur ist, dass alle Analysen und Pläne für die ökologische Transformation der Entwicklung und Umgestaltung von Produktionsprozessen eine Schlüsselrolle einräumen, manchmal mit Hilfe von Innovation, aber vor allem durch die Verbreitung bereits existierender Innovationen. Die Reduzierung der Nachfrage stellt in den Szenarien, die ich kenne, weniger als 20% der kumulierten Emissionsreduktion dar. Außerdem beträgt die kurze Zeit, von der wir sprechen, immer noch 30 Jahre. Also scheint es mir, dass die Hebel, die ich im Buch anspreche, sehr relevant für die Transformation sind.
Ich sprach bereits zuvor über die Rolle von Bildung und der Soziodemografie der Innovator:innen. Heute sind Frauen in grünen Innovationen stark überrepräsentiert, um den Faktor drei im Vergleich zu ihrem üblichen Anteil. Meine Schlussfolgerung: Die Änderung der Zusammensetzung der Innovator:innen kann auch die Zusammensetzung der Innovationen ändern.
Geht man weiter, wird die Verbreitung von Innovationen für die ökologische Transformation auch durch bestimmte technische Bereiche erfolgen. Es werden viele Kesselbauer:innen, Schweißer:innen usw. benötigt. Das sind Punkte, die im Buch hervorgehoben werden, wenn ich von schulischer Berufsorientierung in bestimmte technische Bereiche spreche. Heute machen unsere Investitionspläne für die Transformation zu wenig bei Humankapital und beruflicher Orientierung; das ist eine der wichtigen Botschaften des Buches in Bezug auf die Transformation.
Schließlich müssen wir nicht nur schnell, sondern auch effizient handeln. In diesem Zusammenhang widme ich einen ganzen Teil des Buches der Evaluierung von Maßnahmen und wie man die Effektivität öffentlicher Interventionen garantieren kann.
Innovation folgt wachsenden Märkten. Das Problem bei der ökologischen Transformation ist, dass man nicht notwendigerweise den wachsenden Märkten folgen will, sondern die Innovation bewusst in Richtung Emissionsreduzierung lenken möchte. Wie kann man in diese Mechanismen eingreifen? Sollte man weiterhin nach Profitabilität streben oder die Innovation bewusst auf Dekarbonisierung ausrichten?
Es ist notwendig, die Logik der Marktgröße zu nutzen, um Innovation in Richtung der Ziele des ökologischen Wandels zu lenken. Es gibt zwei Hauptansätze.
Zuerst die Regulierung. Zum Beispiel, das Verbot von Verbrennungsmotoren für neue Fahrzeuge in der Europäischen Union ab 2030: Das ist ein enormer Motor für die Produktion von Elektrofahrzeugen. Die andere große Kategorie staatlicher Intervention ist das Preissignal, also die CO2-Steuer. Der Emissionshandel umfasst heute 40% der Emissionen in Europa: Das ist erst der Anfang, er muss weiter ausgebaut werden.
Aber ich denke, ein Teil Ihrer Frage bezieht sich auf den Kompromiss zwischen der Rentabilität der Investitionen, um die Transformation kostengünstig zu gestalten, und sicherzustellen, dass sie überhaupt stattfindet. Mein Eindruck ist, dass man selten vor diesem Kompromiss steht: Es besteht kaum die Gefahr, dass wir in Frankreich durch übermäßige Rentabilität öffentlicher Ausgaben über das Ziel hinausschießen. Es scheint mir, dass wir sowohl schneller als auch effizienter sein können.
Die Rolle des Staates
Ein Schlüsselpunkt Ihres Buches ist, dass der blinde Fleck der Innovationspolitik in Frankreich das nationale Bildungssystem und die Hochschulbildung sei. Sie beklagen insbesondere den Rückgang des Bildungsniveaus in Umfragen und heben dessen Kosten für die französische Wirtschaft hervor. Woher kommt dieser Rückgang und was kann man dagegen tun?
Zunächst einmal: Was genau ist der Zusammenhang zwischen Bildung und Innovation? Das allgemeine Bildungsniveau eines Landes ist ein Schlüsselfaktor für die Ausbreitung von Innovationen. Innovationen stammen immer von den am besten Gebildeten. Wenn es nun eine grundlegende Ungleichheit zwischen den am besten und am wenigsten Gebildeten gibt, wird diese durch die Dynamik der Innovationsverbreitung verstärkt. Wir haben ein sehr ungleiches System und darüber hinaus ist es insgesamt nur wenig leistungsfähig. Das Buch macht eine Bestandsaufnahme dieser schlechten Leistung, selbst für die besten Schüler:innen, und beschreibt auch die Bildungsungleichheiten. Ich komme zu dem Schluss, dass Bildung das wichtigste Problem für die Wirtschaftspolitik in Frankreich geworden ist, insbesondere für die Innovationspolitik.
Dann schlage ich drei Arten von Maßnahmen vor. Die Erste ist, das Niveau aller Schüler:innen zu heben (einschließlich der besten Schüler:innen, die von den besten Schüler:innen im Ausland abgehängt werden). Es gibt viele Werkzeuge, von den Lehrplänen über pädagogische Praktiken bis hin zur Klassengröße und Hausaufgabenhilfe. Dabei muss man sich jedoch auf die Ergebnisse bestehender Evaluierungen stützen und die Mittel mit den langfristigen Zielen, die wir verfolgen, in Einklang bringen.
Das scheint mir bisher zu fehlen. Wir wissen, dass es keine magische Lösung gibt, es braucht unterschiedliche Maßnahmen. Aber heute haben wir in Frankreich kein langfristiges Ziel, um unser Bildungsniveau über die Zeit anzuheben. Bei vielen anderen Themen haben wir das, etwa beim Arbeitsmarkt oder der öffentlichen Verschuldung.
Es gibt sinnvolle Mittel wie die Halbierung der Klassengrößen, aber die Effekte sind im Vergleich zu den Herausforderungen gering. Jüngste Studien zur Bildungsreform von 2017, durchgeführt von den statistischen Diensten des Bildungsministeriums, zeigen das. Die Herangehensweise muss es sein, verschiedene Maßnahmen zu kombinieren, um den Trend umzukehren. Andere Länder haben es geschafft, einen Impuls zu geben, wie Deutschland und Portugal, die ihren „PISA-Schock“ hatten. Anfang der 2000er Jahre wurden Hunderte von Artikeln in der Presse veröffentlicht. Im Gegensatz dazu sprechen wir in Frankreich sehr wenig über diese Themen, weder in den Medien noch politisch. Ohne eine öffentliche Debatte wird sich nichts ändern.
Die zweite Art von Maßnahmen betrifft technische Bereiche, darüber haben wir gerade gesprochen, und die dritte Art sind spezifischere Reformen, um bestimmte Lehrinhalte zu stärken, die sich auf Nutzung neuer Technologien oder auf Programmieren beziehen. Zum Beispiel gibt es in der fünften Klasse Technologieunterricht und etwas Programmieren im Mathematikunterricht, aber das ist sehr wenig und wir sollten, viel mehr tun.
Es gibt also zwei Haupttypen von Reformen: einmal jene, die das Bildungsniveau verändern, und jene, um auf einem gegebenen Niveau die Karrieren in Richtung Wissenschaft und Innovation zu lenken.
Gibt es nicht einen Zielkonflikt zwischen der Anpassung der Fähigkeiten an den bestehenden Arbeitsmarkt und der Wiederbelebung der Innovation? Wenn man sich die Arbeitslosenquote der Jugendlichen und deren Entwicklung in den letzten Jahren ansieht, könnte man denken, dass wir nicht so schlecht abschneiden.
Ich denke, es gibt zwar einen Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit, aber der hängt stark mit der Lehrlingsausbildung und dem allgemeinen Trend des Rückgangs der Arbeitslosigkeit in Frankreich seit 2015 zusammen. Tatsächlich sieht man diesen Rückgang auch im Rest der Europäischen Union. Ich sehe nicht, dass die jüngsten Bildungsreformen den Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit maßgeblich beeinflusst haben.
In Ihrer Frage steckt auch ein philosophisches Element: Man kann niemanden zwingen, sich für bestimmte Studienrichtungen zu entscheiden, auch wenn man denkt, dass es beruflich besser wäre. Die Idee ist mehr, diese Berufe kennenzulernen, zu sagen, dass es eine Option ist, und dass jeder dann entsprechend seinen Vorlieben entscheiden kann. Gehen wir noch einmal zurück zu dem Beispiel, das ich vorhin über die Studie in Frankreich genannt habe: die Mädchen, die sich vermehrt für wissenschaftliche Vorbereitungsklassen entschieden. Niemand hat ihnen gesagt, dass sie es tun müssen. Es ist nur so, dass sie sich damit ursprünglich nicht identifizieren konnten. Erst nach der Vorstellung des Berufsbildes entschieden sie sich, diesen Weg zu gehen. Es geht nicht darum, Zwang auszuüben oder Gesetze mit Zielquoten für bestimmte Studienrichtungen auszuarbeiten. Jedoch sollten allgemeine Bildungsprogramme ehrgeizige Ziele für die Anhebung des allgemeinen Bildungsniveaus haben, wie es in Deutschland und Portugal geschehen ist. Das Kennenlernen von Berufen sollte auch eine wichtige Rolle im Schulsystem spielen.
Das SGPI (Anm.: dt. Generalsekretariat für Investitionen) oder die großen Institutionen zur Finanzierung von Innovationen in Frankreich finanzieren heute keine Studien oder Initiativen, die sich mit Bildung oder Berufsorientierung befassen. Sie sollten das tun, denn dieses Thema steht im Mittelpunkt unserer Innovationsfähigkeit.
Ihrer Meinung nach hat der Staat drei Rollen in der Innovationspolitik: Er organisiert die Bildung des Humankapitals, darüber haben wir gerade gesprochen, er finanziert Innovationen und er definiert und reguliert Märkte. Es scheint also, dass er keine Rolle in der Ausrichtung der Innovation hat. Ihre Vision könnte daher im Widerspruch zu einem unternehmerischen Staat stehen, der bereit ist, Risiken einzugehen oder gerade Entscheidungen für bestimmte Innovationen zu treffen.
Um das zu präzisieren: Es ist nicht so, dass ich dem Staat diese Rolle abspreche, aber das sollte keine Priorität im französischen Kontext sein, weil wir tatsächlich schon viele Dinge in diesem Geist machen. Mit „France 2030“ zum Beispiel haben wir 50 Milliarden Euro über zehn Jahre bereitgestellt und große technologische Richtungen vorgegeben. Wir haben auch viele Investitionspläne wie das Programme d’investissement d’avenir (Anm.: dt. Zukunftsinvestitionsprogramm).
Was man mit diesen Plänen machen muss, ist, sie effektiv zu gestalten. Deshalb halte ich die Evaluierung von staatlichen Maßnahmen für zentral. Das vermisse ich schmerzlich in den Arbeiten zum unternehmerischen Staat, etwa von Marianna Mazzucato und Dani Rodrick.
Wie baut man einen unternehmerischen Staat auf? Indem man ihn effizient macht. Man gibt ihm außerdem eine herausragende Schlüsselrolle. Man denkt nicht wirklich im Rhizom, sondern bleibt im Mythos des Trickle-Downs. Bloß wird dabei der Staat an die Stelle des Unternehmers gesetzt. Wir brauchen einen anderen politischen Geist, der von Anfang an eine Rolle für die größtmögliche Anzahl von Menschen vorsieht. Das geht über Bildung und Berufsorientierung. Andernfalls ist es nicht mehr eine kleine Zahl von Unternehmer:innen, sondern eine kleine Zahl hochrangiger Beamter, die diese Diskussionen führen und Innovation lenken. Oft sind es auch die großen, etablierten Unternehmen, die sich für eine bestimmte Ausschreibung entscheiden können, weil sie bereits ein wenig in die entsprechende Richtung positioniert sind.
Die Notwendigkeit für Planung entsteht auch aus der Diskrepanz zwischen dem sozialen Wert und dem privaten Ertrag einer Innovation. Der Bedarf an ökologischer Planung entspricht dieser Notwendigkeit, aber sie beseitigt nicht das Problem der Finanzierung. Welche Möglichkeiten sehen Sie?
Für mich ist der Hauptbremsfaktor für die Transformation der Wirtschaft das Humankapital und nicht Finanzierungsfragen. Nur um eine Größenordnung zu geben: Man kann über die Zahlen debattieren, aber in Bezug auf zusätzliche Finanzierungen repräsentiert die ökologische Transformation zwischen einem und zwei Prozent des BIP, das erklärt nicht, warum wir ein Haushaltsdefizit von 5 Prozent haben. Durch die Steigerung der Effizienz der öffentlichen Ausgaben gibt es viele andere Bereiche, in denen wir tatsächlich Finanzierungsmöglichkeiten finden können, um Innovation und ökologische Transformation zu finanzieren.
Sie legen großen Wert auf die Governance von Innovation und befürworten insbesondere die Schaffung von Beratungsorganisationen innerhalb des CESE (Anm.: dt. Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat). Welche Rolle würden Bürgergremien bei der Ausrichtung von Innovationen spielen, und wer hätte die Macht, die Agenda zu setzen?
Die allgemeine Idee ist, dass viele technologische Entscheidungen getroffen werden, aber am Ende sind es meistens Unternehmer:innen oder die Verwaltungselite, die sie treffen. Bürger:innen haben selten ein Mitspracherecht. Man könnte sagen, das ist normal, weil es technische Themen sind. Aber ich denke, dass wir uns damit nicht zufriedengeben können.
Wir können und müssen der Gesellschaft insgesamt eine direktere Rolle geben, damit die Bürger:innen gleichberechtigt an Innovation teilhaben. Ich sehe zwei mögliche Rollen. Die erste ist, Bürger:innen in die Evaluierungsmethoden einzubeziehen, sowohl in Bezug auf die Bewertung von Ergebnissen als auch in Bezug auf die Entscheidung, Mittel auf die wirksamsten Maßnahmen umzuleiten. Die zweite Rolle könnte in Fällen, in denen die Entscheidungen tatsächlich ethischer und philosophischer Natur sind, in einer Bürgerkommission liegen. Das wäre nützlich bei Themen wie der Verwendung von ChatGPT in Schulen oder der Finanzierung von Forschung über seltene Krankheiten. Es gibt Beispiele im Ausland, insbesondere in Dänemark, wo sie das „Board of Technologies“ nennen. In Frankreich könnten wir das tun, indem wir Organisationen wie den CESE und das SGPI näher zusammenbringen.
Sie sind Vorsitzender des Evaluierungskomitees von „France Relance“ (Anm.: 2020 beschlossener Investitionsplan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise), das im Dezember seine Ergebnisse vorlegen wird. Tatsächlich ist eines der wiederkehrenden Motive Ihres Buches der Mangel an Evaluierungspraxis oder vielmehr die schlechte Nutzung von Evaluierung. Sie deuten insbesondere darauf hin, dass die Finanzierung großer Investitionspläne in Frankreich wenig durch bestehende oder mögliche Evaluierungen geleitet wird.
In der Tat kann man immer Evaluierungen durchführen, in denen gemessen wird, ob es keine Korruption gegeben hat oder ob die Mittel wirklich dort ausgegeben wurden, wo es vorgesehen war. Wir machen das, aber das ist nicht interessant, um wirklich zu identifizieren, was funktioniert und wo es Mitnahmeeffekte gibt. Sie können ein Start-up staatlich finanzieren, aber wenn es ebenso von einem privaten Akteur finanziert werden könnte, ist es sinnlos, öffentliche Gelder dafür zu verwenden.
Ich denke, es gibt zwei große Probleme. Das eine ist, dass es oft keine kausale Evaluierung gibt. Weir wissen oft nicht, ob das Programm wirklich funktioniert hat oder nicht. Das zweite Problem: Selbst, wenn es gute Evaluierungen gibt, werden sie nicht verwendet, um die Maßnahmen neu auszurichten. Das muss geändert werden. Im Buch beschreibe ich, wie man das tun kann, insbesondere für große Investitionspläne wie „France 2030“. Bei „France 2030“ werden 70% der 50 Milliarden Euro in Form von Ausschreibungen vergeben. Sie haben also Gewinner und Nicht-Gewinner, was es ermöglicht, eine Kontrollgruppe im Vergleich zur Experimentalgruppe zu definieren (Nicht-Gewinner:innen und Gewinner:innen, deren Anträge ähnliche Bewertungen knapp über oder unter dem Auswahlkriterium erhalten haben). Es gibt einige Themen, bei denen die Evaluierung sehr schwierig ist, aber hier haben Sie vergleichbare Unternehmen, die Empfänger oder Nicht-Empfänger von Geldern sind, und es geht einfach darum, sie zu vergleichen. Das könnte man schnell in großem Umfang tun.
Dafür müssen lediglich die Daten über alle Bewerber:innen bei Ausschreibungen aufgehoben und die Gewinner:innen mit den Nicht-Gewinner:innen verglichen werden. Das Buch geht genauer darauf ein, wie das gemacht werden kann. Trotzdem nenne ich mal ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat. Die USA haben im Ausgang der Finanzkrise 2009 grüne Innovationsprogramme mit Upstream- und Downstream-Finanzierung aufgelegt. Bei der Evaluierung dieses Programms stellten sie fest, dass Upstream-Finanzierungen im Vorlauf (zu Beginn des Lebenszyklus eines Start-ups) einen großen Anreizeffekt hatten, während Downstream-Finanzierungen nur private Finanzierungen ersetzten. Auf Basis dieser Evaluierung wurden alle Mittel auf Upstream-Finanzierung umgeleitet.
Es gibt einen Mangel an Evaluierungsangeboten, insbesondere in Frankreich, wo die Verwaltung nur selten fortgeschrittene Evaluierungsmethoden einsetzt. Wie kann dieser Mangel behoben werden?
Sie haben absolut recht. In Frankreich haben wir mehrere große Forschungsinstitute, wie zum Beispiel das OFCE und das IPP, die diese fortgeschrittenen Evaluierungsmethoden verwenden und oft von den Verwaltungen konsultiert werden. Allerdings können sie nicht unbegrenzt viele Evaluierungen durchführen, und es wäre sehr nützlich, wenn die Verwaltungen mehr interne Evaluierungskompetenzen entwickeln würden. In Bezug auf die Bewertung von Innovationspolitik, mit einem bedeutenden Budget von 50 Milliarden Euro, haben wir genügend Kompetenz, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wenn es in unserem Land immer noch Lücken im Bereich der Evaluierungsangebote gibt, ist das kein Grund, die Transformation der Evaluierung politischer Maßnahmen nicht sofort zu beginnen.
Zum Abschluss: Das Institut Avant-garde hat die Mission, „den wirtschaftlichen Geist zu transformieren“. Ihrer Meinung nach, welches Problem im Bereich der Innovation erfordert am dringendsten eine Transformation dieses Geistes?
Drei Hauptpunkte kommen mir in den Sinn. Erstens, wir müssen der Bildung Priorität einräumen. Das ist entscheidend für eine effektive Innovationspolitik. Zweitens, philosophisch müssen wir einen „Rhizom“-Ansatz statt eines Trickle-Down-Ansatzes verfolgen. Es geht nicht nur darum, Technologien zu schaffen, sondern auch darum, sie zu verbreiten. Drittens ist es entscheidend, eine Evaluierungskultur zu etablieren.
Xavier Jaravel ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics and Political Science. Im Jahr 2021 erhielt er den Preis für den besten jungen Ökonomen, der von der Zeitung „Le Monde“ und dem „Cercle des Économistes“ vergeben wird. Laut der IDEAS/RePEc-Rangliste 2023 wird er unter den weltweit am häufigsten zitierten jungen akademischen Ökonomen in den Top 5 geführt.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts- Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an levi.henze[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte